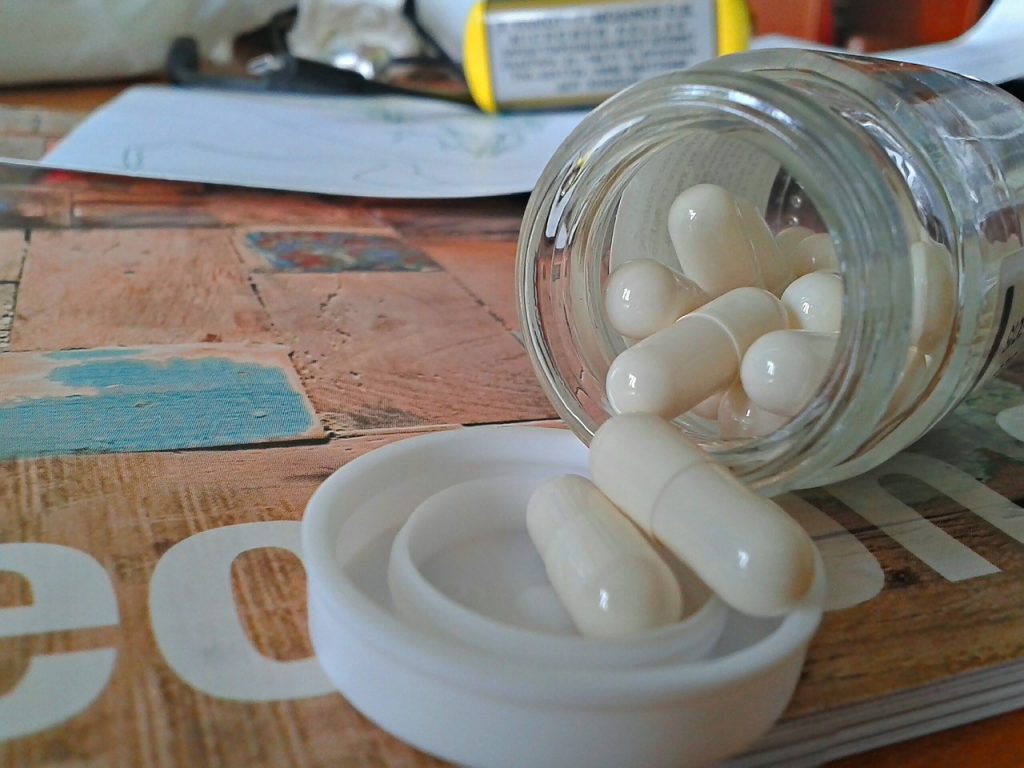Die Reise unserer Tablette geht weiter! Der Arzneistoff hat es geschafft! Er ist drin im Blut. Aber wie geht es jetzt weiter?
Um das verstehen zu können, stellen wir uns mal vor, wir würden über Google Earth – ausgehend von der Erdkugelansicht – in einer ganz bestimmten Straße nach einem ganz bestimmten Haus mit einer ganz bestimmten Haustür suchen. Und an genau dieser Haustür wollen wir klingeln und schauen, was passiert.
Arzneistoffe müssen sich an etwas binden, um einen Effekt in unserem Organismus auslösen zu können.
Diese Bindungsstellen nennt man Rezeptoren – und jetzt sind wir bei unserer Haustür angekommen! Wenn wir uns unseren Körper nämlich als einen Planeten vorstellen, auf dem unzählige Häuser stehen (im übertragenen Sinne die Zellen unseres Körpers), dann wären die Schlösser der Haustüren gewissenmaßen die Rezeptoren. Ja, genau! Schlüssel-Schloss-Prinzip! Davon hast du bestimmt schon mal was gehört. Der Arzneistoff braucht also einen Schlüssel (in der Fachsprache nennt man den Ligand), mit dem er die Haustür aufschließen kann. Und wie im echten Leben auch, passt ein Schlüssel nicht in jedes Schloss.
Schlüssel gibt es viele: Gerade, gezackte, für Altbautüren, für Sicherheitsschlösser und für das Auto mit Funk. Genauso verhält es sich mit den Liganden. Es gibt körpereigene und solche, die von außen in den Organismus kommen.
Körpereigene Liganden heißen auch „endogene Liganden“. Dazu gehören beispielsweise Hormone oder Neurotransmitter. Und dann sind da noch die exogenen Liganden, von denen uns jetzt besonders die Arzneimittel interessieren.
Stellen wir uns mal vor, du wärst kein besonders guter Beifahrer, weil dir in jeder Kurve übel wird. Dein Körper verkraftet die ständigen Richtungswechsel nicht gut und dir ist hundeelend. Diese Übelkeit wird von einem körpereigenen Botenstoff – Histamin – ausgelöst. Durch die Schaukelei wird vermehrt Histamin gebildet, das sich nun über das Blut auf den Weg zu seinen Rezeptoren macht. Dort dockt es an. Steckt der Schlüssel (Histamin) im Schloss (Rezeptor), löst das ein Signal im Brechzentrum aus: Bitte dringend mal rechts ranfahren!
Löst die Bindung eines Arzneistoffs an einen Rezeptor ein solches Signal aus, nennt man den Arzneistoff „Agonist“. Ein Agonist ahmt also die Wirkung eines körpereigenen Stoffes nach.
Zum Glück gibt es für Menschen, die unter Reiseübelkeit leiden, hilfreiche Medikamente. Dimenhydrinat oder Diphenhydramin zum Beispiel. Diese beiden Arzneistoffe setzen sich anstelle des Histamins an den Rezeptor und blockieren ihn. Dann passiert allerdings nicht mehr viel, denn diese Arzneistoffe können keine Signalweiterleitung an das Brechzentrum anstoßen, und somit gibt es auch keinen Brechreiz.
Substanzen, die eine Signalweiterleitung blockieren, nennt man Antagonisten, oder „Gegenspieler“.
Ein Arzneistoff kann also entweder vorgeben, ein körpereigener Bote zu sein und ein entsprechendes Signal auslösen. Oder er blockiert eben jene Signalwirkung.
Und warum gibt es zu so ziemlich jeder Wirkung auch eine Nebenwirkung? Demnächst mehr… 😉
Danke, dass du dich um die Arzneimitteltherapiesicherheit deiner Bewohnerinnen, Bewohner, Patientinnen und Patienten kümmerst 
Christine